Ein Film von Max Ahrens & Maik Lüdemann
[Credits] [Tickets & Termine] [Trailer]
Deutschland steht an einem historischen Wendepunkt: Erstmals seit 1945 wird im Jahr 2025 ein migrationspolitischer Entschließungsantrag im Bundestag angenommen – mit Unterstützung der AfD, die vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Bestrebungen beobachtet wird. Die Erklärung zur Begrenzung der Zuwanderung sieht unter anderem eine vollständige Schließung der deutschen Grenzen vor. Ein Paradigmenwechsel kündigt sich an: weg vom Schutz von Geflüchteten, hin zu Abschottung und Abschreckung.
Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes begibt sich auf die Suche nach den Ursachen dieser politischen Zäsur und nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine aufrüttelnde Reise. Die Dokumentation beginnt an den europäischen Außengrenzen, wo eine andauernde humanitäre Katastrophe auf staatliche Ignoranz trifft, aber auch auf ziviles Engagement. Sie begleitet einen Rettungseinsatz auf dem Mittelmeer, dokumentiert die katastrophale Lage aus der Luft und erzählt die Geschichten von Überlebenden, die trotz Gewalt und tödlicher Risiken den Weg nach Deutschland gefunden haben.
Während Deutschland dazu beiträgt, eine europäische Festung zu errichten, gerät die politische Landschaft ins Wanken. Von emotionalisierten Medienberichten bis zu hilflos nach rechts rudernden Politiker*innen zeichnet sich eine gesellschaftliche Erzählung ab, die sich gegen Migrant*innen und Schutzsuchende richtet. Ist Migration überhaupt das große Problem, zu dem es gemacht wird? Oder offenbart die Abschottungspolitik tiefere gesellschaftliche Ängste?
In eindringlichen Geschichten zeigt der Film eine zunehmend beängstigende Realität aus Sicht von Geflüchteten und analysiert die Dynamiken hinter dem historischen Rechtsruck. Im Dialog mit Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Publizist*innen fordert Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes dazu auf, den brutalen Status quo und die scheinbar unaufhaltsame Radikalisierung der Migrations- und Asyldebatte in Frage zu stellen.



Credits:DE 2025, 111 Min., OmU
Regie: Max Ahrens & Maik Lüdemann
Kamera: Nils Kohstall, Maik Lüdemann
Schnitt: Lino Thaesler
Trailer:nach oben




















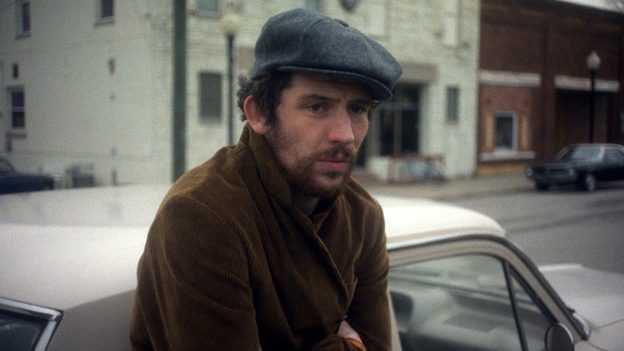



















 English
English