Ein Film von Ounie Lecomte.
Elisa ist Physiotherapeutin und nimmt für einige Monate eine Vertretungsstelle in Dünkirchen an. Vor 30 Jahren wurde sie dort anonym geboren und direkt zur Adoption freigegeben. Obwohl sich ihre Mutter nach wie vor nicht zu erkennen geben möchte, hofft Elisa auf ein Einlenken oder auf den Zufall. Ihr Sohn Noé (Elyes Aguis) muss sich in der neuen Schule zurechtfinden und wird auf Grund seiner leicht dunklen Hautfarbe für einen Ausländer gehalten. Unterschwellige Vorurteile begleiten den Alltag in Schule und Stadt, Vorurteile die auch Annette teilt, die in der Schule als Putzfrau arbeitet und von den Schülern gehänselt wird. Bald wird Annette Patientin bei Elisa, anfangs entwickelt sich eine gewisse Nähe zwischen den beiden ungleichen Frauen, die eine in Paris aufgewachsen und weltoffen, die andere vom kleingeistigen Wesen der Kleinstadt geprägt und noch im Haus der eigenen Mutter lebend.
„Es ist nie ein Rätsel in Ounie Lecomtes Ich wünsche dir ein schönes Leben, wer die Mutter ist, alle Karten liegen auf dem Tisch. Doch eine tiefe emotionale Spannung trägt den Film – und die multiperspektivische Erzählweise macht ihn vielschichtiger, als eine bloße Inhaltsangabe zu vermitteln vermag. (…) Der Film heißt im Original direkt übersetzt „Ich wünsche dir, verrückt geliebt zu werden” – die verrückte Liebe, die amour fou, das ist hier die zwischen Mutter und Kind – der Titel bezieht sich auf André Bretons L’Amour fou, das am Ende des Films, wie aus dem Nichts, von einem Voice Over rezitiert wird, ein Brief an die zukünftige Tochter, voll überwältigender Liebe, die gewünscht wird für sich und für andere …”
(Harald Mühlbeyer – kino-zeit.de”
Je vous souhaite d’être follement aimée
Frankreich 2015, frz. OmU, 100 Min.
Regie: Ounie Lecomte
Buch: Ounie Lecomte, Agnès de Sacy
Kamera: Caroline Champetier
Schnitt: Tina Baz
Darsteller: Céline Sallette, Anne Benoit, Elyes Aguis, Françoise Lebrun, Louis-Do de Lencquesaing, Pascal Elso, Micha Lescot, Catherine Mouchet

























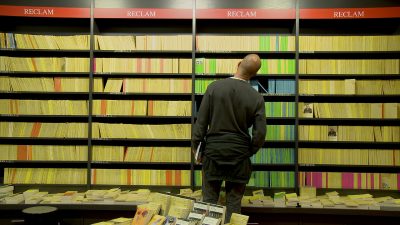











































 English
English