A film by Kirill Serebrennikov. In German and Spanish with German subtitles.
[Credits] [Tickets & Termine] [Trailer]
The film follows Nazi physician Josef Mengele in the years following the end of the Second World War, detailing his later life in Argentina, Paraguay, and Brazil. The film explores his relationships with his second wife Martha and his estranged son Rolf as he justifies his actions at Auschwitz concentration camp.




Credits:FR/MX/DE/GB 2025, 135 Min., deutsch, spanische OmU,
Regie: Kirill Serebrennikov
Kamera: Vladislav Opelyants
Schnitt: Hansjörg Weißbrich
mit: D: August Diehl, Max Bretschneider, Dana Herfurth, Friederike Becht, Mirco Kreibich, David Ruland
Audiodeskriptionen, Untertitel und Hörverstärkung mit der Greta App
Trailer:nach oben













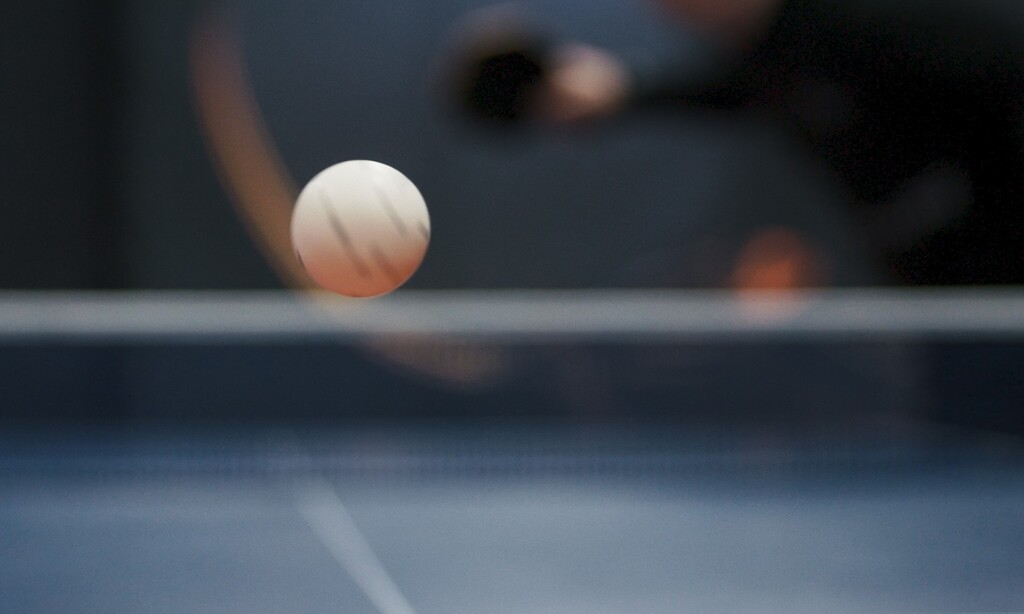
























 Deutsch
Deutsch