Ein Film von Wes Anderson.
Dass nur vier Jahre nach „The Grand Budapest Hotel“ erneut eine Berlinale mit einem Film von Wes Anderson eröffnet, hat fraglos auch damit zu tun, dass das einflussreiche Medienboard Berlin-Brandenburg Geld in beide Produktionen steckte, Hauptgrund ist allerdings zweifelsohne, dass es Anderson wie kaum ein anderer Regisseur versteht, faszinierende Oberflächen zu kreieren, hinter denen – wenn man mag – vielfältige Subtexte zu entdecken sind.
Die Oberfläche von „Isle of Dogs“ ist diesmal besonders atemberaubend, denn zum zweiten Mal nach „Der fantastische Mr. Fox“ hat Anderson einen Animationsfilm gedreht, im klassischen Stop-Motion-Verfahren, durch dessen handgemachte Qualität die ungefähr einen halben Meter großen Figuren eine bemerkenswerte Lebensnähe bekommen. Den Hunden in erster Linie, denn um des Menschen besten Freund geht es in diesem Abenteuer bzw. um eine Welt, in der diese Freundschaft zerbrochen ist.
In einem leicht futuristischen Japan, der Metropole Megasaki spielt die Geschichte, eine Stadt, die vom mächtigen Kobayashi-Clan beherrscht wird, der eine besondere Vorliebe für Katzen hat. Dementsprechend schwer haben es die Hunde, die zunehmend unter Diskriminierung leiden, aber auch an einer endemischen Hunde-Grippe, einem Problem, das Kobayashi mit einer extremen Entscheidung lösen will: Alle Hunde sollen ins Exil abgeschoben werden, auf eine Müllinsel, wo sie fortan ohne ihre menschlichen Herrchen existieren.
Allein der 12jährige Atari will sich nicht damit abfinden, dass sein Hund Spots ins Exil geschickt wurde. Doch seine Rettungsaktion scheitert, bis er von einer Gruppe Hunden mit so klingenden Namen wie Chief, King, Rex und Boss gefunden und quasi adoptiert wird. Doch während sich die meisten Hunde darüber freuen, endlich wieder einem Herrchen gehorchen zu dürfen, verweigert der Streuner Chief die Gefolgschaft. Er lehnt jegliche Unterwerfung unter die Menschen ab, was wiederum Atari überaus irritiert. In Megasaki schmiedet Kobayashi derweil finstere Pläne und plant, dem Hundeproblem endgültig Herr zu werden: Mittels Vernichtungslager.
Fast schon frivol mutet es an, wenn über solch einem Lager, ein leicht gerundetes, schmiedeeisernes Schild hängt, auf dem man „Welcome Dogs“ lesen kann, in unverkennbarer Anspielung an das „Arbeit macht frei“-Schild in deutschen Konzentrationslagern. Doch ehe man sich fragen kann, ob solch eine Anspielung vielleicht etwas schwierig ist, ist Wes Anderson längst drei, vier Einfälle weiter, reißt der kaum zu Ruhe kommende Fluss von „Isle of Dogs“ weiter, weiter zu den nächsten fantastischen Bildern, vollgestopft mit Anspielungen an japanische Filme, die Popkultur, aber auch an die Großmeister der japanischen Animation von Hokusai bis Miyazaki.
In einer Sichtung ist kaum zu erfassen, mit welchen Reichtum an Bildern und Verweisen Anderson die 100 Minuten seines Films gefüllt hat, die er in seinen typischen zentrierten Tableaus, mit Reißschwenks und Parallelfahrten inszeniert. Eine Vielfalt, die sich auch in den Geschichten spiegelt. Um die Beziehung zwischen Mensch und Tier geht es, vor allem aber um das Verhältnis von Lebewesen im Allgemeinen, um Vorurteile und Diskriminierung, Exil und Vertreibung. Zeitgemäße Themen, die in „Isle of Dogs – Ataris Reise“ aber niemals didaktisch verhandelt werden, sondern auf mitreißende, enorm phantasievolle Weise erzählt werden.
Michael Meyns | programmkino.de
- Isle of dogs
Credits
USA 2018, 101 Min., engl. japan. OmU
Regie & Buch: Wes Anderson
Kamera: Tristan Oliver
Animation: Mark Waring
Montage: Andrew Weisblum
Termine:
- noch keine oder keine mehr









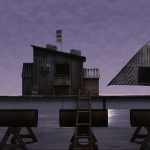












 English
English