ein Film von Salomé Jashi.
[Indiekino Club] [Credits] [Tickets & Termine] [Trailer]
Ein Mann sammelt Bäume.
Gut – Bäume sind keine Briefmarken oder Sammeltassen, aber was es bedeutet wenn ein über 100-jähriger Baum ausgegraben, abtransportiert und über das Meer zu seinem Bestimmungsort, einem Privatpark , verschifft wird, ist schwer zu formulieren – aber elementar einfach zu empfinden.
Salome Saschi findet in ihrem Film Bilder, die uns tief im Unterbewussten bewegen. Wenn eine Dorfgemeinschaft dem verkauften Baum wie in einer Trauerprozession nachzieht, oder ein riesiger Baum auf einem Frachtkahn über das Meer geschoben wird.
Bäume begleiten Generationen von Menschen, ein 100 jähriger Baum 4 Generationen, ein 200 jähriger Baum 8 Generationen. Deutschlands berühmteste Baumdenkmäler sind 500 bis 1200 Jahre alt, entsprechen 20 bis 48 Generationen, die neben diesen Bäumen ihr Leben gelebt haben.
Auch bei uns wird Bäumen oft ihre Alltäglichkeit zum Verhängnis, man bemerkt sie erst wenn sie krank sind oder gefällt werden sollen, wenn sie irgendeinem Plan im Wege stehen.
So ist „Die Zähmung der Bäume“ ein Plädoyer dafür geworden Bäume zu bemerken,
und in seiner jeweiligen Umgebung über die Geschichte eines Baums nachzudenken.
Die meisten Baumdenkmäler in Deutschland sind Bäume die sich auf einer Dorfalmende oder einem Park erhalten haben.
Viele hundertjährige Bäume bilden Alleen aus der Gründerzeit, oder stehen in Parks, Friedhöfen und in privaten Gärten, vor allem gegen Ende des zweiten Weltkrieges wurden in den städtischen Parks viele Bäume durch die Bombardierungen zerstört, oder in den ersten Nachkriegsjahren als Brennstofflieferant abgeholzt. Dadurch sind über 100 jährige Bäume auch in Deutschland in besiedelten Gebieten sehr selten.
In Wäldern die forstwirtschaftlich genutzt werden stehen auch Laubbäume selten länger als 100 Jahre.




Credits:CH/DE/GE 2021, 92 Min., georgische OmU
Regie und Buch: Salomé Jashi
Kamera: Goga Devdariani, Salomé Jashi
Schnitt: Chris Wrightenn
Trailer:nach oben












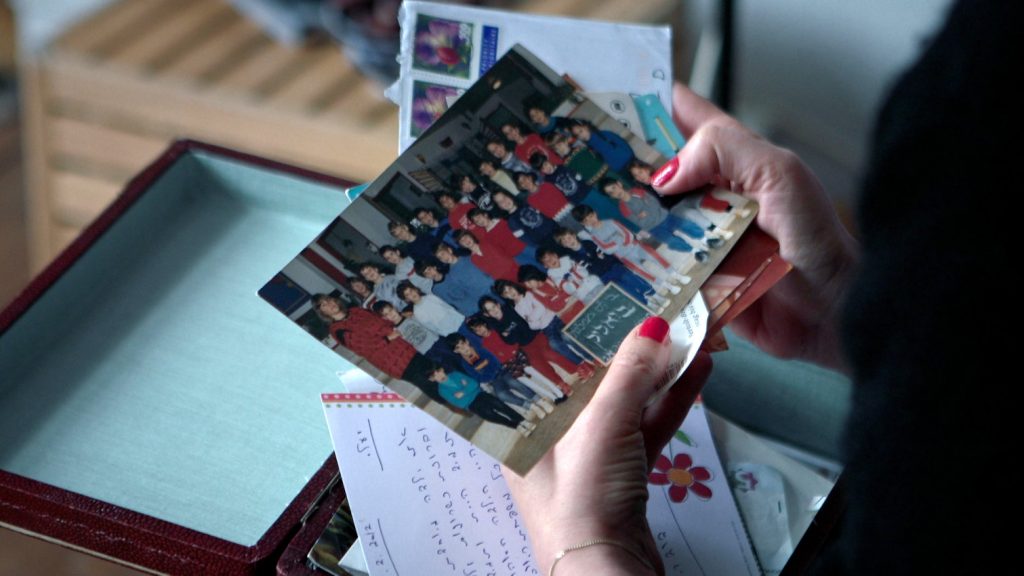


















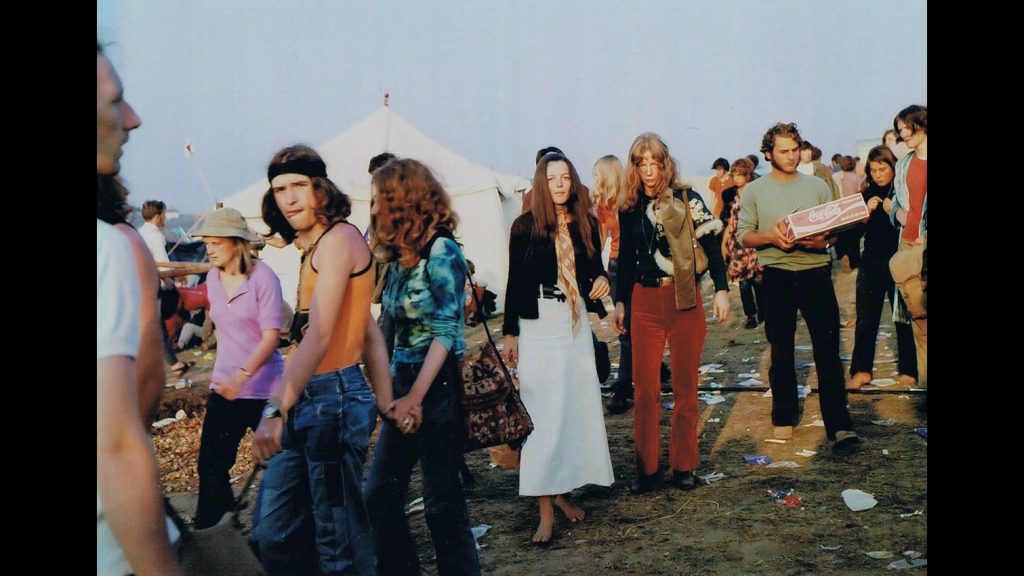

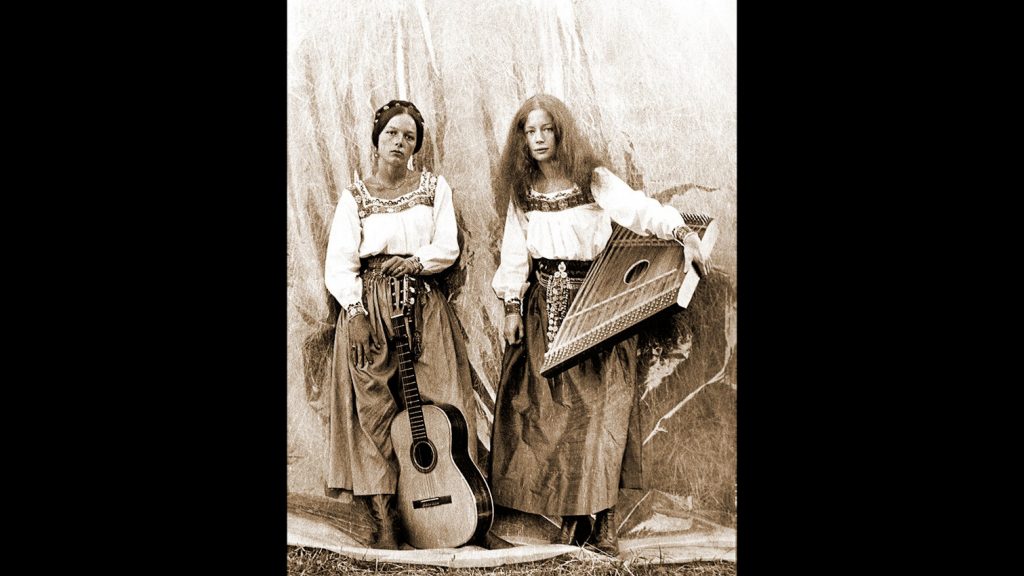






 English
English